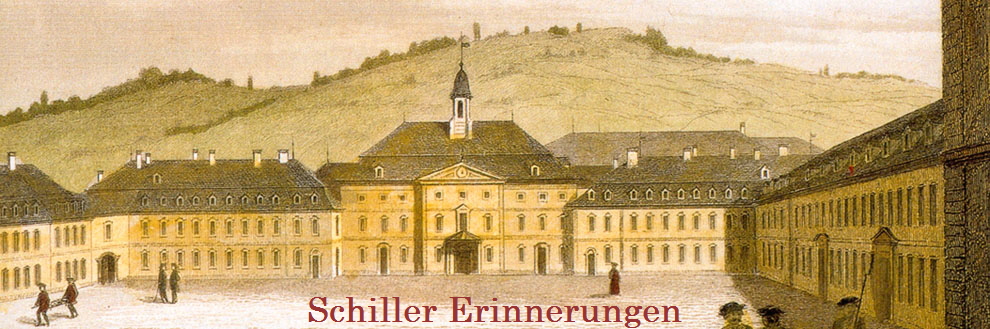
Die Braut von Messina wird beendigt
Nach sechs arbeitsreichen Wochen, die zwischendurch von Fieber und Krämpfen begleitet wurden, umfasste mein neues Werk bereits 1500 Verse, und ich erlebte eine deutliche Verjüngung der Form des Stückes. Es war ein frei erfundenes Schicksalsdrama, das von zwei Orakelsprüchen erzählte, die sich bis ins Letzte erfüllen sollten, wobei ich die christliche und maurische Religion mit der griechischen Götterlehre zu einer Einheit verschmelzen ließ. Ich versuchte darzustellen, dass selbst das scheinbar eigenwillige Handeln vorbestimmt und schicksalsbedingt sei.
Anfang des Jahres 1803 rückte die Beendigung des Werkes in greifbare Nähe, die sich aufgrund von Schlaflosigkeit und meiner unsteten Gesundheit verzögert hatte.
Trotz des recht milden Winterverlaufs saß ich wie in Klausur in meinen Arbeitsräumen und hatte schon lange das Haus nicht mehr verlassen.
Zum Jahreswechsel wurde mir ein Neujahrs-Präsent in Höhe von 650 Reichstalern anonym aus Frankfurt ausgezahlt.
Ich erkannte jedoch, dass es sich um eine Zuwendung des seit 1802 als Erzbischof und Kurfürst zu Mainz amtierenden Karl Theodor von Dalberg handelte, der aus Gründen diplomatischer Rücksichtnahme auf den Herzog Karl August nicht als mein offizieller Förderer genannt werden wollte.
Ende Juni des Jahres 1804 wurden mir nochmals 542 Reichstaler angewiesen.
So setzte ich mir zum Ziel, die Tragödie Die Braut von Messina bis zum Geburtstag Dalbergs am 8. Februar 1803 abzuschließen, um ihm mit meinem Manuskript zu danken, ohne ihn jedoch öffentlich in irgendeiner Weise zu nennen.
Als ich zu Beginn des Februars mein Ziel erreichte, folgte am 4. Februar eine erste Lesung meines Werkes, auf Wunsch des Herzog von Meiningen in festlicher Atmosphäre, zu dessen Geburtstag. Da ich von der Wirkung meines Vortrages nicht überzeugt war, überraschte mich der große Zuspruch, den ich im Anschluss daran erfuhr. Nur wenige Zuhörer standen dem antiken Charakter der Tragödie eher skeptisch gegenüber, fanden die Dialoge zu ernst oder bemängelten, wie der Herzog, das Ungleichmäßige des Versbaues und die Neigung zum Sentenziösen.
So sehr ich mich anfangs gegen die häufige Anwesenheit bei Hofe ausgesprochen hatte, so sehr wurde sie mehr und mehr zur Selbstverständlichkeit. Am selben Tage las ich erneut vor der Herzogin in größerer Runde und erfuhr ebenfalls große Zustimmung.
Um etwaige Fehlinterpretationen meines Stückes zu vermeiden, entschloss ich mich dazu, für die Buchausgabe eine Erläuterung Über den Gebrauch des Chors in der Tragödie voranzusetzen, welche die Konzeption des Stückes genau erklären sollte. Nach einer Leseprobe mit den Schauspielern am 27. Februar wurde die Uraufführung auf den 19. März 1803 in Weimar festgelegt.
Nach langem Drängen hatte sich Karl die kleine Rolle eines Pagen erbettelt, die Rolle der Donna Isabella, Fürstin von Messina, übernahm die junge Schauspielerin Anna Amalia Malcolmi, die Rolle der Beatrice wurde von Mademoiselle Jagemann gespielt.

Gleich zu Beginn des Stückes wurde beim Erscheinen beider Chöre, zum Marsch, den das Orchester spielte, ein taktgleicher kriegerisch antiker Kriegstanz aufgeführt, und diese Art der Darstellung zog sich ballettartig durch das ganze Stück. Als in letzter Szene der tote Prinz getragen wurde, hatte ich den Eindruck eines wirklichen Trauerspiels.
Doch nach der Schlussszene kam es in der allgemeinen Begeisterung zu einem peinlichen Zwischenfall. Das applaudierende Publikum wurde durch einen mir äußerst unangenehmen Vivatruf aufgeschreckt, den mir der Sohn des Herausgebers der „Allgemeinen Literatur Zeitung“, Christian Gottfried Schütz, im begeisterten Überschwange zugerufen hatte.
Da nach höfischem Gesetz eine solche Huldigung nur alleine dem Herzog entgegengebracht werden durfte, versuchte ich durch ein lautes Zischen den Jüngling zum Schweigen zu bringen, woraufhin das gesamte Publikum mit einstimmte.
Der junge Schütz erhielt auf Veranlassung des empörten Herzogs eine Verwarnung durch den Jenaer Stadtkommandanten, und er entschuldigte sich später, indem er versicherte, er habe diese Art von Beifallsbezeugung auf Ersuchen der zahlreich anwesenden Jenaer Studenten kundgetan.
Weiter
>