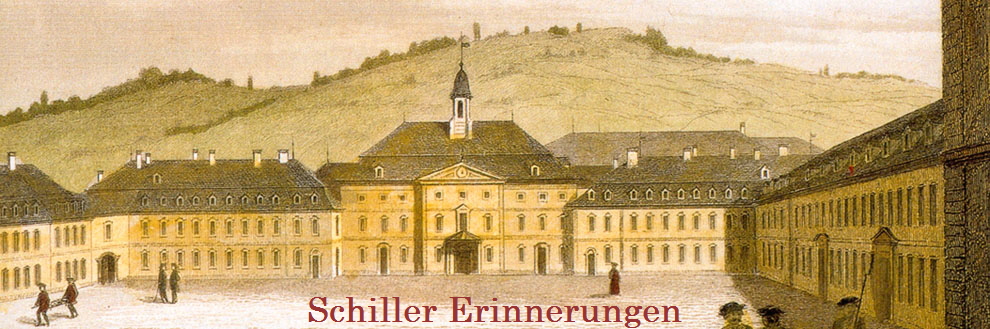
Phédre und Demetrius

Zwischenzeitlich hatte „Die fränkische Staats- und Gelehrte Zeitung“ die Nachricht von meinem Tod in Umlauf gebracht, die auch unseren alten Freund Fischenich erreichte, der sich nun bei uns meldete. Fischenich lebte immer noch in Bonn, wo im Oktober seine Schule, an der er als Professor für Gesetzgebung gelehrt hatte, aufgelöst worden war.
Wir hatten uns sehr darüber gefreut, dass sich jemand freundschaftlich an uns erinnerte, und Lotte riet Fischenich dazu nach Aschaffenburg zu gehen, wo er vielleicht im Dienste Dalbergs eine Zukunft hätte.
Als die Festivitäten in Weimar zu Ende gingen, die allen Beteiligten unvergesslich blieben, fanden wir wieder allmählich in unseren Alltag zurück.
Da ich an vielen Veranstaltungen teilgenommen hatte, machte sich meine immer schwächer werdende körperliche Widerstandskraft erneut mit einem Katarrh bemerkbar. So war ich trotz bestem Willen nicht arbeitsfähig.
Mein Schwager hatte mittlerweile für mich den Brillantring der Zarin für 500 Reichstaler veräußern können, so dass ich damit die Hypothek meiner Schwiegermutter tilgen konnte.
Bis Mitte Dezember besserte sich mein Zustand nicht, und obwohl ich mich deswegen zum Demetrius nicht durchringen konnte, kam mir Jean Racines Tragödie „Phèdre“ in den Sinn, und ich erinnerte mich an den Vortrag Madame de Staëls. Mein Geist suchte nicht nur eine Ablenkung von meinem körperlichen Leiden, sondern ich wollte mir selbst beweisen, dass ich noch lebte und handeln konnte, und da ich des Herzogs Vorliebe für dieses französische Stück kannte, beschloss ich, eine Übersetzung für den Geburtstag der Herzogin Ende Januar zu fertigen. Am 14. Januar 1805 konnte ich meine Arbeit beenden und sandte das Manuskript kurz vor der Aufführung an den Herzog Karl August. Obwohl dieser das Werk in den höchsten Tönen lobte, ließ er mir Anfang Februar eine Liste mit fünfzig Korrekturvorschlägen zukommen, die mich veranlassten, das Stück von Goethe durchsehen zu lassen, um es später an Iffland nach Berlin zu schicken.
Obwohl ich noch immer unter den Auswirkungen des Katarrhs litt, kümmerte ich mich um die Bearbeitung einer „Othello“- Übersetzung, mit der sich der seit 1804 in Weimar lebende Gymnasialprofessor Voß, Lehrer meiner beiden Söhne, und ehemaliger Hauslehrer von Goethes Sohn August, derzeit beschäftigte, um das Stück für das Weimarer Theater tauglich zu machen. Außerdem hatte ich meinen Demetrius fortgesetzt wann immer meine Krankheit es zuließ.

Zu Jahresbeginn überraschte mich eine Trauerbotschaft, die mir sehr zu Herzen ging, denn ich erfuhr von Cotta, dass mein einstiger Freund Ferdinand Huber im Alter von erst vierzig Jahren in Ulm verstorben war. Ich erinnerte mich an die gemeinsamen Zeiten in Gohlis, die schon so weit zurück lagen und bedauerte immer noch, dass aus ihm nur ein Mainzer Jakobiner geworden war, der sich damals gegen Dora Stock und für Therese Forster entschieden hatte, die ich insgeheim für seinen Weggang von Dresden mitverantwortlich machte.
Anfang Februar wurde ich von neuen Fieberanfällen heimgesucht, und meine Kinder plagten sich mit Windpocken. Auch Goethe blieb in diesem Winter von Krankheit nicht verschont, denn er war ebenfalls seit Dezember durch einen heftigen fieberhaften Katarrh mehr oder weniger ans Bett gefesselt. Im Januar folgte eine Lungenentzündung, und im Februar gesellten sich schwere Nierenkoliken hinzu, die ihm sehr zusetzten.
Voß war in großer Sorge um uns, denn er wachte oft nächtelang abwechselnd an Goethes und an meinem Bett, auch um Lotte zu entlasten. Die Krankheit hielt mich in ihren unbarmherzigen Klauen, und ich versuchte Lotte gegenüber meine Ohnmachtsanfälle zu verbergen, die Folgen der immer wiederkehrenden Schmerzen waren.
Die ganze Familie litt mit mir. Auch die Kinder, die es gewohnt waren, dass wir bei den Mahlzeiten zusammen am Tisch saßen, wo wir uns neckten und liebkosten, verstanden nicht, warum dies nur noch selten möglich war.
Trotz meines eigenen miserablen Zustandes versuchte ich Goethe zu besuchen, doch die Krämpfe hinderten mich daran, und mir war bange an die Luft zu gehen. Nur am 1. März konnte ich mich dazu durchringen. Auch Voß war anwesend, als Goethe und ich uns in einem langen, herzlichen Kusse um den Hals fielen.
Dann hüteten wir beide das Haus, doch ich freute mich, dass diese betrübliche Situation dazu beigetragen hatte, wieder ein paar handschriftliche Zeilen von Goethe in meine Hände zu bringen, denn es belebte meinen Glauben, dass die alten Zeiten zurückkommen könnten, wonach ich mich oft so sehr sehnte.
Doch es waren vor allen Dingen Unterlagen und Papiere, die Goethe mir zur Durchsicht sandte, weil er sie in der Zeit seiner Krankheit nicht erledigen konnte. Er gab mir seine Last, ohne zu bedenken, dass die meine groß genug war, doch ich trug sie für ihn, so oft er wollte.
Weiter
>