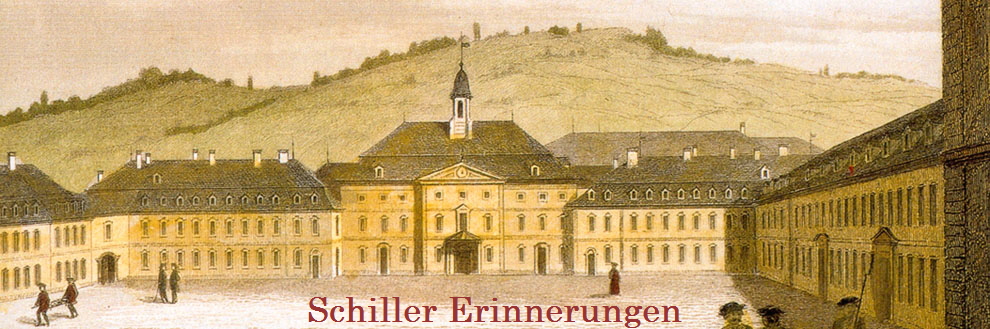
Revolutionswehen

Wieder war ein Jahr vergangen, und das Brodeln und Kochen in den politischen Tiegeln Europas sollte erst richtig beginnen, nachdem Frankreich ihren König wegen Hochverrats auf der Guillotine hingerichtet hatte. 1793 traten England, die Niederlande, Spanien, Sardinien und Portugal in den bisher von Preußen und Österreich geführten Krieg gegen die Franzosen ein. Ich hatte aufgehört, französische Zeitungen zu lesen, weil mich die elenden Schinderknechte anekelten.
Nicht nur deswegen sah ich mit wenig guten Gedanken den nächsten Monaten entgegen, sondern auch, weil sich in der kalten Jahreszeit mein Leiden stets zu verschlimmern pflegte. So hatte ich mich mittlerweile darauf eingestellt, im Winter besondere Rücksicht auf meine Lungen und Bronchien und im Frühling und Sommer verstärkt auf meinen Darm zu nehmen. Es galt, heftige Fieberanfälle und Koliken zu verhindern.
Ablenkung fand ich bei meinen Kant-Studien, die mich immer weiter zu tieferen Erkenntnissen brachten. Ich hatte mir vorgenommen, im zweiten Heft der Neuen Thalia eine Abhandlung Über Anmut und Würde zu schreiben und begann deshalb mit Körner einen regen Briefaustausch, auch, um zu Ostern eine über Kant hinausgehende Theorie über die Ästhetik, Kallias oder über die Schönheit herauszugeben.
Dem Prinzen Friedrich Christian von Augustenburg teilte ich mein beschlossenes Wagnis mit. Da ich momentan selbst nicht dazu in der Lage war, Kunst auszuüben, weil es dazu eines gesunden und freien Geistes bedurfte, wollte ich die gewonnene Zeit dafür nutzen, um über ihre Prinzipien nachzudenken.
Noch bevor ich mit meinen Ideen über die Philosophie des Schönen an die Öffentlichkeit trat, gedachte ich diese dem Prinzen in einer Reihe von Briefen zur Einsicht und Beurteilung zuzusenden, was erstmals im Juli geschah. Je tiefer ich in die Schriften Kants eintauchte, umso mehr zogen sie mich in ihren Bann. Deshalb ließ ich mir durch meinen Drucker Göpferdt das neueste Werk Kants „Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“, als willkommene Lektüre aushändigen, weil dieses gerade für Kants Verleger in Königsberg gedruckt worden war.
Mittlerweile war der Koadjutor, der sich seit dem Herbst in Konstanz aufgehalten hatte, nach Erfurt zurückgekehrt. Er musste hier damit umgehen lernen, mit einem um die Hälfte verringerten Gehalt auszukommen, das man ihm ohne Rücksicht gekürzt hatte. Auch die Nachricht Körners, über das weitere Schicksal Hubers hatte mich erschreckt, denn er wollte seinen Dienst quittieren und die Frau Forsters heiraten. Wie sollte er alleine von der Schriftstellerei leben können? Ich war der Ansicht, dass sich diese Frau mit ihren Kindern nur von ihm versorgen lassen wollte, und das machte mich sehr wütend auf sie und Hubers Situation.
weiter
>