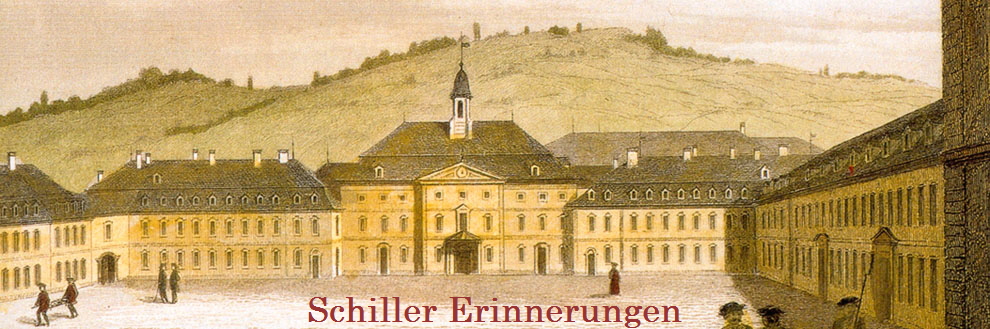
Plan der Xenien
Goethe sah in Kürze Vaterfreuden entgegen. Ich schlug vor, dass es ein Mädchen werden sollte, damit wir uns später miteinander verschwägern könnten. Stattdessen wurde ihm am 1. November 1795 ein Sohn geboren.

Goethe kam am 5. November nach Jena und wollte bis zu meinem Geburtstag bleiben. Wir saßen tagtäglich, manchmal bis 1 Uhr nachts zusammen und schwatzten über Gott und die Welt.
Am Tage meines Geburtstages wurde Goethe plötzlich durch einen Brief der Vulpius abberufen, weil sich das Neugeborene in einem kritischen Zustand befand. Goethe, der zum vierten Male Vater wurde und bereits den Tod seiner beiden letzten Kinder verschmerzen musste, fuhr sofort nach Weimar zurück.
Sein Sohn starb ab 16. November 1795, was wir mit Bestürzung zur Kenntnis nahmen, doch fand ich es allemal erträglicher ein gerade neugeborenes Kind zu verlieren, als ein Kind, das einem nach langen Jahren ans Herz gewachsen war und in das man alle seine Hoffnungen gesetzt hatte. Doch auch hier vermieden es Lotte und ich, über Christiane Vulpius zu reden. Also verharrten wir erst einmal in betroffenem Schweigen, bis Goethe sich im Dezember wieder meldete.
Endlich, am 3. Januar, besuchte uns Goethe erneut und blieb bis zum 17. Tag des neuen Jahres. Er nahm mir alle Abendstunden und brachte eine große Unruhe in mein Leben, zumal er sehr große Freude an unserem nun zweijährigen Karl hatte, dessen Nähe mir immer mehr zum Bedürfnis wurde, so sehr, dass mir manches Mal bange wurde, weil ich Glück bisher als sehr kurzlebig empfunden hatte.
Goethe und ich, wir steckten die Köpfe zusammen wie zwei Lausbuben und gebaren ein Kind des unbeschwerten Übermutes, das sich zu einem ungezogenen, wilden Bastard entwickeln sollte.
Spottverse nach antikem Muster hatten wir uns ausgedacht. Goethe, der mit Rang und Namen auf der sicheren Seite stand, hatte nicht viel zu befürchten gehabt, doch ich vergaß, dass ich meinen guten Ruf sehr schnell wieder verlieren oder beschmutzen konnte. Doch wollten wir unserem Ärger, der uns aufgrund der unerfreulichen Kritik über Die Horen seitens der Leserschaft im Innersten erschüttelte, ordentlich Luft machen.
Mindestens 100 Xenien sollten für den Musen-Almanach für das Jahr 1797 entstehen, insgesamt wurden 414 gedruckt. Es war klar und beabsichtigt, dass alle Welt schrecklich darüber schimpfen würde, aber jeder würde neugierig danach greifen und es kaufen. Der Druck würde die Massen in Bewegung setzen und in seiner Härte und Schärfe das Herbste sein, was die Deutsche Presse je veröffentlicht hatte.

Von allen Seiten waren inzwischen Anfeindungen laut geworden. Man sprach davon, dass der Druck der Horen bereits nach dem ersten Erscheinen hätte eingestellt werden müssen, weil jeder Leser damit unzufrieden sei. Der „Allgemeinen Literatur Zeitung“, die in den Rezensionen der Horen stets des Lobes voll war, warf man vor, sie habe sich wie eine Dirne verkauft und meiner Philosophie lastete man an, sie sei noch unverständlicher, als die von Kant. Das Ganze sei zu komplex und für den Laien nicht nachvollziehbar; noch dazu wäre es allzu langatmig und dadurch langweilig.
Mir wurden die ständigen Wortgefechte und Kleinkriege, die im Kreise der an den Horen beteiligten Schriftsteller kaum beizulegen waren, immer mehr zuwider. So sehr ich mich für das Erscheinen der Zeitung eingesetzt hatte, so sehr war sie mir nun lästig geworden, und ich zog mich so gut es ging aus dem Geschehen zurück. So steuerte ich im Jahre 1797 nur zwei kleine Beiträge bei und gab Die Horen mit dem 12. Stück des Jahrgangs 1797 endgültig auf, unter anderem wegen zurückgehender Absatzzahlen.
Weiter
>