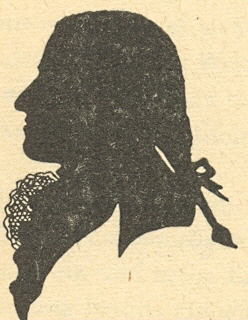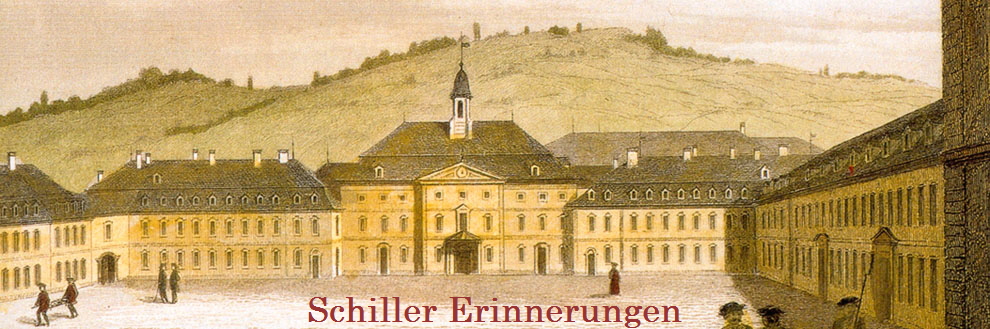
Ich befand mich im Niemandsland, umgeben von unsäglich drückenden Verpflichtungen. Mein Vertrag war ausgelaufen, und der Traum vom Glück zu Dritt in Bauerbach, nach einigen unbesonnen geschriebenen Briefen zu Ende. Weil ich mich so sehr in die Nähe von Henriette von Wolzogen zurück gewünscht hatte, hatte ich dummerweise vor ein paar Wochen, in meiner Verzweiflung und der schönen Erinnerungen wegen, um die Hand ihrer Tochter angehalten. Dies wäre für mich die einzige Möglichkeit gewesen, meinen Traum zu erhalten.
Lotte, für mich ein durchaus begehrenswertes Geschöpf und ihre Mutter, die ich inniglich liebte, wären zusammen, nebst ländlich geliebter Idylle, die Idealverbindung gewesen, die ich mir nur allzu oft ausgemalt hatte. Sie hätten mir ein Zuhause geboten, eine Sicherheit und Basis. Doch, als ich mir selbst darüber klar wurde, dass ich ihnen von meiner Seite aus nichts hätte bieten können, hatte ich diese Gedanken wieder verworfen noch bevor ich eine Absage meiner Freundin erhielt. Es schien mir ohnehin, als hätte ich sie verloren, denn mein Unvermögen, meine Schulden auszugleichen, hatte mich in ein falsches Licht gerückt.
Unentschlossenheit begleitete mich wochenlang. Was sollte ich anfangen, alleine und mittellos? Sollte ich mich erneut in den Kerker einer Brotwissenschaft begeben und mein Medizinstudium fortsetzen oder dem Rufe des Gottes folgen, der in mir nicht ruhen wollte?
Meine Willenskraft hatte gelitten, denn die Bearbeitung meines bereits in Bauerbach begonnenen Don Carlos wollte keine Fortschritte machen. Sollte ich sie überhaupt fortsetzen? Vielleicht wäre es besser, einen zweiten Teil der Räuber zu schreiben, der die Dissonanzen des ersten Teils auflöste?! Es war eine Zeit des Zweifelns, der Wahl und der Unsicherheit!
Ich trug mich mit Ideen, wie Shakespeares „Macbeth“ und „Timon“ für die Bühne umzuarbeiten. Zuletzt aber entschloss ich mich dazu, Dalbergs ernsthaftem Rat Folge zu leisten und den 1. Teil des Don Carlos fertigzustellen.
Das Thema dieser Tragödie war mir fremd geworden, doch da sich Dalberg auch nach der langen Zeit immer noch dafür ausgesprochen hatte, nahm ich die Arbeit daran wieder auf. Je weiter ich in die Materie vordrang, desto leichter kamen die Erinnerungen wieder. Noch intensiver machte ich mich mit der Geschichte des fürstlichen Hauses vertraut, kreierte das Familienbild dieses Adelsgeschlechtes und das des Herzogs Alba als Vollstrecker der Inquisition. Ich erzählte die Geschichte des Vaters, seines unglücklich liebenden Sohnes und dessen Freund Marquis von Posa.
Es war eine Geschichte, in der ich auf die Unfreiheit der Völker aufmerksam machen und die Verbrüderung und Gedankenfreiheit derselben als höchstes Menschenideal darstellen konnte. Menschlichkeit, heroisches Selbstgefühl und Freiheit entsprachen meinem eigenen Lebensprinzip.
Dieses Stück sollte anders werden, als meine ersten Werke. Ich versuchte mich an ähnlichen zu orientieren, wie beispielsweise Schauspiele von Racine, Corneille und Voltaire. Mäßigen wollte ich meine oft zu überschwängliche Einbildungskraft und war mitunter entschlossen, einige dieser Stücke der deutschen Bühne zugänglich zu machen.
Es erfüllte mich mit Befriedigung, die Arbeit mit wachsendem Fortschritt aus meiner Feder fließen zu sehen. Plötzlich konnte ich wieder an mich und meine Zukunft glauben, und ich musste mir eingestehen, dass ich mich beim Schreiben dieser Tragödie in einem Metier befand, welches ich wie kein anderer beherrschte. Anders als bei Kabale und Liebe konnte dies von keinem anderen übertroffen werden.
Tagelang schrieb ich wie besessen, und mit jeder neuen Zeile wuchs meine Begeisterung. Mit Ungeduld sah ich den Abendstunden entgegen, in denen ich meinem Mitbewohner Streicher meine Tagesarbeit vorzulesen pflegte. Dieser war ein begeisterter Zuhörer, der meiner glatt dahinfließenden Dichtung wie einem gut gespielten Musikstück folgte. Meine Jamben-Dichtung schien ihn zu faszinieren, und er beschwor mich, niemals mehr in Prosa zu schreiben.
Doch meine Schulden und die erschwerten Lebensumstände drückten wie eine schwere Last auf meiner Brust.
So musste ich alle Kräfte aufbringen, nicht nur, um das Stück weiter zu schreiben, sondern auch, um für meinen Lebensunterhalt zu sorgen und gleichzeitig die Schulden zu verringern.
Aufgrund meiner bisherigen Tätigkeit am Theater war es naheliegend, dass ich es zum Thema meiner nächsten Arbeit machte. So beschloss ich, eine Zeitschrift herauszugeben, dessen Themen hauptsächlich dem Theater gewidmet waren. Alles, was die Menschen glücklich machte, sollte hierin zu finden sein. Die Rheinische Thalia sollte sie heißen und der Verkauf meine finanzielle Not ein wenig lindern.
Um die erfolgreiche Veröffentlichung zu sichern, musste ich zuvor das Vertrauen des Publikums gewinnen. Also begann ich mich mit diesen Worten vorzustellen: „Ich schreibe als Weltbürger, der keinem Fürsten dient!“ Mein Vaterland hätte ich gegen die große Welt getauscht, die ich nur aus Erzählungen und aus der Ferne kennen würde. Ich erzählte meine Lebensgeschichte, von meiner Flucht und allen aufgelösten Verbindungen. Mein Publikum sei nun alles, was mir noch geblieben sei, und nur dessen Gericht und Urteil würde ich mich stellen. An keinen weltlichen Thron würde ich appellieren und keine Fesseln tragen, nur einen einzigen Anspruch hätte ich, und der sei an die menschliche Seele gerichtet.
Ich war in erhabener Stimmung und genau diese ließ ich in die Ankündigung meiner Zeitschrift einfließen. Frei gemacht hatte ich mich von allen Zwängen, von aller Last und mein Freiheitsprinzip zum Ideal erkoren. Kraft und Hochgefühl hatten Schwäche und Sehnsüchte überwunden und meinen Geist aus den Fesseln der Autorität befreit.
Weiter
>